Mode und Trends gaben einen schon immer gerne Rätsel auf. Bis zur späten Jugend beeinflussen sie bei vielen die Kaufentscheidung. Danach ist es zunehmend die Persönlichkeit, die Hose oder Hemd für einen aussucht. Eine natürliche Entwicklung. Was kümmert es auch, wenn die Modeketten jedes Jahr neue Flausen kreieren und dem Esel die Karotte vor die Nase halten? Man muss den Zirkus ja nicht mitmachen, kauft was gefällt und achtet mehr auf Qualität als auf Staffage. Doch spätestens dann, wenn eine neue Herrenjeans fällig wird, und man verärgert feststellt, dass in den meisten Läden nur noch Modeelend angeboten wird, kommt man ins Grübeln. Und fragt sich, was gerade mal wieder schief läuft. Dass früher vieles anders, aber nicht unbedingt alles besser war, zeigt diese kleine Reise in Sachen Modetrends der Achtziger, Minimalismus und der mühsamen Suche nach einem überzeugenden Kleidungsstück.
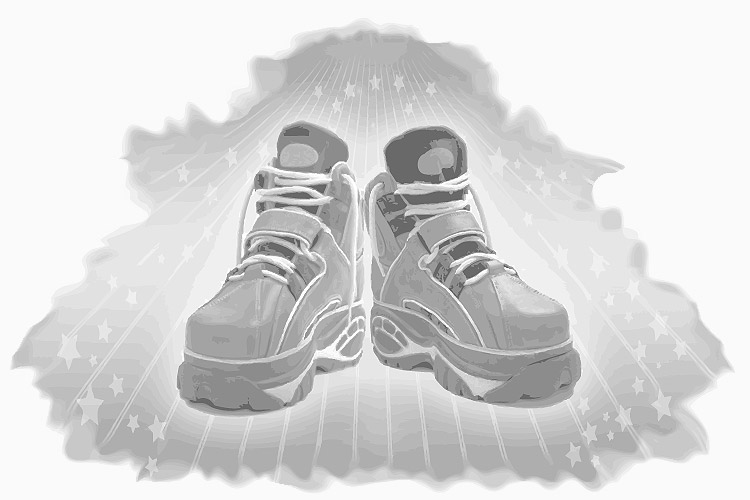
Schuh oder Bremsklotz? Modetrends gaben schon immer gerne Rätsel auf.
Der viel verwendete Begriff „Mode“ (Art, Weise) bezeichnet grob gesagt Bräuche und Sitten, die in einem Kulturkreis zu einem Zeitpunkt vorherrschen und den allgemeinen Geschmack widerspiegeln. Mode ist somit eine Momentaufnahme. Und natürlich nicht nur auf Kleidung beschränkt, sondern kann sich auch auf Musik, Erziehungsmethoden oder die derzeit angesagten Vornamen bei Babys beziehen. Der Begriff „Trend“ (Tendenz) wurde im 20. Jahrhundert aus dem Englischen entlehnt. Im Vergleich zur Mode kennzeichnet er nicht einen aktuellen Zustand, sondern eine Tendenz, in welche Richtung sich ein Zustand demnächst entwickeln könnte. Der Trend ist somit keine Momentaufnahme, sondern viel mehr eine Prognose mit unsicherer Komponente. Aus Trends müssen nicht zwangsläufig Moden werden – auch wenn das bei Kleidung in der Regel der Fall ist. So bezeichnet das Determinativkompositum Modetrend eigentlich die Mode, die im kommenden Quartal für volle Kassen sorgen wird. Auch wenn es gern synonym für den Fummel verwendet wird, der aktuell gerade angesagt ist.
Modewelt der Achtziger – Musik beeinflusste Farbe und Form
Die Achtziger waren bekanntlich ein Jahrzehnt der Gegensätze. Unterschiedlichste Musikströmungen und Lebenseinstellungen prallten aufeinandern, die auch alle die Mode mit beeinflusst haben. Man sah schmächtige Typen in übergroßen Schulterpolster-Anzügen, die Aerobic-Welle ließ die Leute mit Stirnband zu Diskomusik herumzappeln, und neben Pastellfarben mischten besonders grelle Neonfarben die Mode auf. Turnschuhe zum Anzug, weiße Tennissocken, Vokuhila-Schnitt – und fertig war der Inbegriff des schlechten Geschmacks. Als Kontrast zum Mainstream sah man oft den verwahrlosten Mix aus zerrissener Hose, Punkfrisur und Stinkefinger-Aufnähern. Und nicht zu vergessen die New-Wave-Ästhetiker in tiefschwarzer Kleidung, hochtoupierter Mähne und der Auflehnung gegen alles Herkömmliche. Auch wenn die Achtziger vieles waren, langweilig waren sie nie.
Solche kollektive Bedürfnisse der Zugehörigkeit und Abgrenzung lassen sich durch Kleidung optimal ausdrücken. So war es zumindest noch bis in die späten Neunziger. Besonders die Musikwelt hatte damals großen Einfluss auf die Kleidung. Vom Prinzip her konnte man bei vielen Leuten auf der Straße sofort erkennen, welche Musikströmung hinter dem betreffenden Outfit stand. Für Außenstehende war es hingegen nicht immer ersichtlich, ob der Typ in englischer Baggy-Jeans, den US-Retro-Sneakern und dem auffallenden Grasgeruch nun zur Hip-Hop- oder Dub-Szene gehört – oder doch eher zu Jungle und Drum ’n‘ Bass abfeiert. Diese starke Präsenz von Subkulturen hat sich inzwischen weitestgehend aufgehoben. Seit dem neuen Jahrtausend erblickt man sowas immer seltener. Und fragt sich, ob Mainstream und Konformität die Subkultur der heutigen Jugend ist?
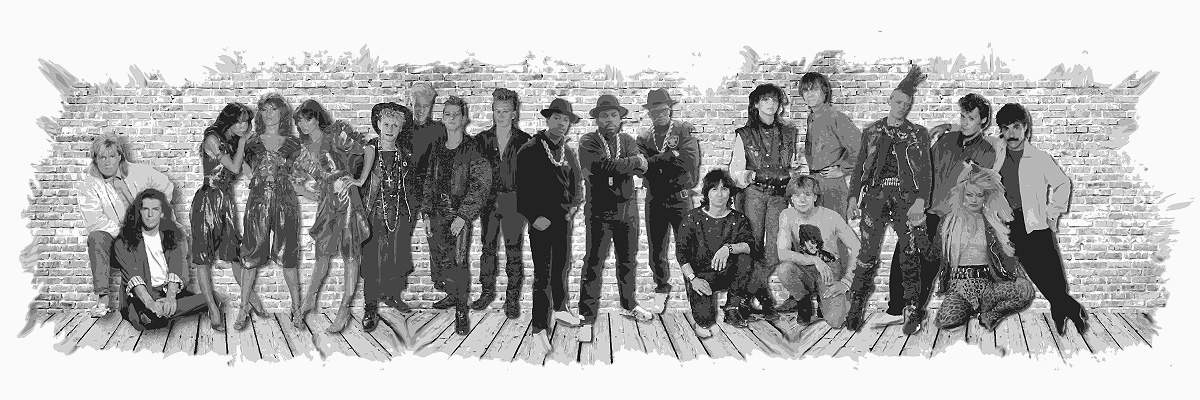
Musiker der Achtziger in typischer Mode: Modern Talking, Arabesque, Depeche Mode, Run DMC, Nena, Nina Hagen, Hall & Oates (von links)
Damals, als Kleidung noch kein Wegwerfprodukt war …
Kleidung war damals viel langlebiger und wurde nicht bei ersten Abnutzungserscheinungen (oder aus Langeweile) gleich durch Neues ersetzt. Und das hatte keine wirtschaftlichen Gründe. Die Jeans wurde beispielsweise bis in die Neunziger noch so lange getragen, bis an Knien und Gesäß die ersten Löcher ausfransten. Dieser getragene und abgenutzte Stil gab der Hose etwas Individuelles und wertete sie sogar auf. Und eine neue wurde erst dann fällig, wenn bei der alten der Hintern schon halb heraushing. Dieser als „Ripped Jeans“ bezeichnete Stil hat seit einigen Jahren wieder den Weg in die Mode gefunden. Mit dem Unterschied, dass die Löcher heute werksmäßig bereits mit dabei sind. Einerseits praktisch, muss man die Hose nicht erst monatelang tragen. Andererseits sieht man den meisten Hosen diese nachträglich einfabrizierten Löcher auch sofort an. Was im Endeffekt eher die gegenteilige Wirkung der Rebellenjeans von damals hervorruft. Das ist ähnlich als wenn man sich einen Jeep mit aufgeklebten Schmutzflecken kauft.
Dass Kleidung damals noch kein Wegwerfprodukt war und für viele einen gewissen Wert hatte, mag auch am kleineren Angebot gelegen haben. In den Innenstädten gab es gerade mal eine Handvoll Lädchen, von denen sich die Hälfte davon auf beige Rentnerkleidung spezialisiert hatte. Moderne Shoppingcenter mit reichlich Klamottenläden waren in den Achtzigern noch Neuland. Und Online-Anbieter existierten erst recht nicht. Heute hat sich das grundlegend geändert. Und man erkennt, dass ein übersättigter Markt auch so seine Schattenseiten hat. Besonders wenn man zu denen gehört, die das Oxymoron „weniger ist mehr“ zu schätzen gelernt haben. Denn dann kommt man sich beim Klamottenkauf ziemlich verloren vor.
Minimalismus und Konsum – ein schwieriges Unterfangen
Als Minimalist hat man es nicht leicht. Basiert unser Wirtschafts- und Wertesystem spätestens seit den Fünfzigern auf möglichst ungezügeltem Konsum. Dabei ist Minimalismus hier keinesfalls mit Konsumverzicht gleichzusetzen. Der Schnorrer am Hauptbahnhof, der außer Hundefutter und Bierdosen kaum etwas erwirbt, ist auf gewisse Weise auch Minimalist. Für mich persönlich bedeutet es aber etwas anderes. Nämlich sich beim Konsum auf solche Produkte zu beschränken, die eine klare Funktion haben. Ihren Preis gerecht sind und ohne überflüssiges Beiwerk einherkommen. Was im Endeffekt in dieser Zeit natürlich auch zu Konsumverzicht führt. Hat man sich auf so eine Sichtweise eingelassen, stellt man fest, dass überzeugende Produkte eher die Ausnahme als die Regel darstellen. Irgendwo hakt es immer. Der Industriedesigner Raymond Loewy hat es vor fünfzig Jahren bereits ganz gut auf den Punkt gebracht, stellte er an Industrieprodukte für den Alltag die Forderung einer Symbiose aus Einfachheit, Funktionalität und Qualität.
Die Formen erwecken alle möglichen unbewussten Assoziationen — und je einfacher die Form, desto angenehmer die hervorgerufene Empfindung.
Raymond Loewy (Industriedesigner, 1883-1986)
Klamotten sind zwar auch Alltagsprodukte, haben aber im Vergleich zu Möbeln, Transportmitteln und den üblichen Staubfängern noch eine weitere Komponente, nämlich das Individuelle. Eine Uniform will man im Alltag schließlich nicht tragen. Und beim Thema Individualität wird es hakelig – sind die Zeiten passé, wo der Schneider einen das Gewand für ein paar Goldmünzen zusammengenäht hat. Das erledigen heute die Nähstuben der Welt in Bangladesch. Die Textilien millionenfach für ein paar Cent am Tag fabrizieren. So gesehen ist das Individuelle futsch, da man sich sicher sein kann, dass Hose, Schuh oder Hemd von irgendeinem Dussel irgendwo anders auf der Welt in diesem Moment auch gerade getragen wird. Individualität lässt sich heute im weitesten Sinne nur noch durch Kombination von Kleidungsstücken erreichen – sofern man nicht seinen privaten Maßschneider beschäftigt. Aber das ist okay, mit diesem Semi-Individualismus bei Kleidung kann man sich anfreunden.

Modische Sneaker als Spiegelbild des kuriosen Zeitgeistes. Klobig, disharmonisch, voller Designexperimente, ohne klare Form und durch und durch künstlich. Diese beiden Exemplare wurden zwar durch künstliche Intelligenz gerendert, nur finden sich solche Klötze inzwischen reihenweise in den Schuhgeschäften im Regal.
Klamottenkauf in heutiger Zeit – leichter gesagt als getan
Mir fallen spontan etliche Sachen ein, die ich lieber tue als durch Klamottenläden zu latschen und neue Anziehsachen zu kaufen. Aber auch lästige Dinge müssen hin und wieder sein. Die Shoppingcenter hingegen sind gefüllt mit Leuten, die offenbar große Freude am Einkauf haben. Wenn man sich das über die vielen prall gefüllten Einkaufstüten herleitet. Für das eine Kleidungsstück, das ich im besten Fall erwerbe, brauche ich natürlich keine Tüte. Dafür viel Leidensfähigkeit. Los geht es damit, erst einmal den üblichen Wust an bizarren Produkten auszusondern, die als hingeklatschtes Etwas aus wahllosen Farben, Formen und Verzierungen herumhängen. Ob das nun die klobigen, mit Wirrwarr überladenen Sneaker sind, (so hässlich, dass sie schon als modernes Kunstwerk durchgehen), oder das T-Shirt voller aufgedrucktem Stuss – es ist nicht leicht, Produkte zu finden, die mit wenigen Farben, einfachen Formen und unaufdringlichen Applikationen einherkommen.
Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann.
Antoine de Saint-Exupéry (Schriftsteller, 1900-1944)
Und hat man so ein Kleidungsstück einmal gefunden, stößt einen das Material sofort sauer auf. Bei Winterjacken hält man schnell ein Ding in der Hand, das mehr Plastikmüll enthält als unsere Zahnpastas vor einigen Jahren. Und bei den Herrenjeans gibt es inzwischen kaum noch ein Exemplar, das nicht so mit Elasthan verunreinigt ist, dass man es eigentlich als Leggins verkaufen müsste. Und wenn neue Schuhe wie alte Autoreifen riechen, fragt man besser erst gar nicht, was da so alles reingekippt wurde. Bleibt zuletzt der Blick aufs Preisschild. Steht die geforderte Summe in keinem Verhältnis zum Gegenwert, dann ist es auch völlig egal, ob ein namhafter Designer irgendeiner Marke hinter der 150-Euro-Jeans steckt. Als wandelnde Litfaßsäule für Markenlogos will ich eh nicht herumlaufen – da gebe ich mein Geld lieber für Nadel und Faden aus und nähe die Löcher der alten Hose einfach wieder zu.
- Herrenschuhe der Gegenwart (durch KI erzeugt)
- Damenschuhe der Gegenwart (durch KI erzeugt)
- Herrenschuhe der Zukunft (durch KI erzeugt)
- Damenschuhe der Zukunft (durch KI erzeugt)
Fazit – eine Epoche, wo Überflüssiges dominiert und Einfaches untergeht
Im Prinzip kann man froh sein, in einer Zeit zu leben, wo Angebot und Produktauswahl so vielfältig wie nie zuvor sind. Und wenn man zu denen gehört, die nicht einfach kaufen, sondern lieber wenig Produkte um sich herum haben, die sich am eigentlichen Bedarf orientieren, lernt man auch, sich sein eigenes Bezugsnetz anzulegen, was wo zu welchen Preisen erhältlich ist. Und man lernt auch, um gewisse Produkte einen großen Bogen zu machen. Schätzt den „inversen Kaufrausch“ – die Freude, mal nichts zu kaufen. Dennoch bleibt der Beigeschmack, auch in einer Zeit zu leben, wo das Überflüssige dominiert und das Einfache immer mehr ausstirbt. Wo krampfhaft in immer kürzeren Zyklen ein künstlicher Bedarf suggeriert wird, der den Konsum stets wieder neu befeuert.
So ist Kleidung wie vieles andere auch zum Wegwerfartikel geworden, der den meisten kaum noch ans Herz wächst und in die Tonne wandert, sobald die großen Modeketten eine neue Kollektion ankündigen. Nur leidet bei zu viel Quantität immer die Qualität. Vieles ist kaum durchdacht und entspringt dem Druck, schnell etwas Neues auf den Markt zu bringen. Und anstatt Energie in Innvovationen wie besonders haltbare oder schmutzresistente Kleidung zu investieren, kommen stattdessen Dinge wie „Jeanshosen mit Tunnelzug“ oder „Sportschuhe mit Rückbeleuchtung“ dabei heraus. Aber sei es drum, man kann es eh nicht ändern. Immerhin blieb uns bislang Marty McFly’s „selbstanziehende Jacke“ verschont, die man sich 1985 in „Zurück in die Zukunft II“ als Zukunftssatire für unsere Gegenwart treffend vorgestellt hat.













Schreibe einen Kommentar